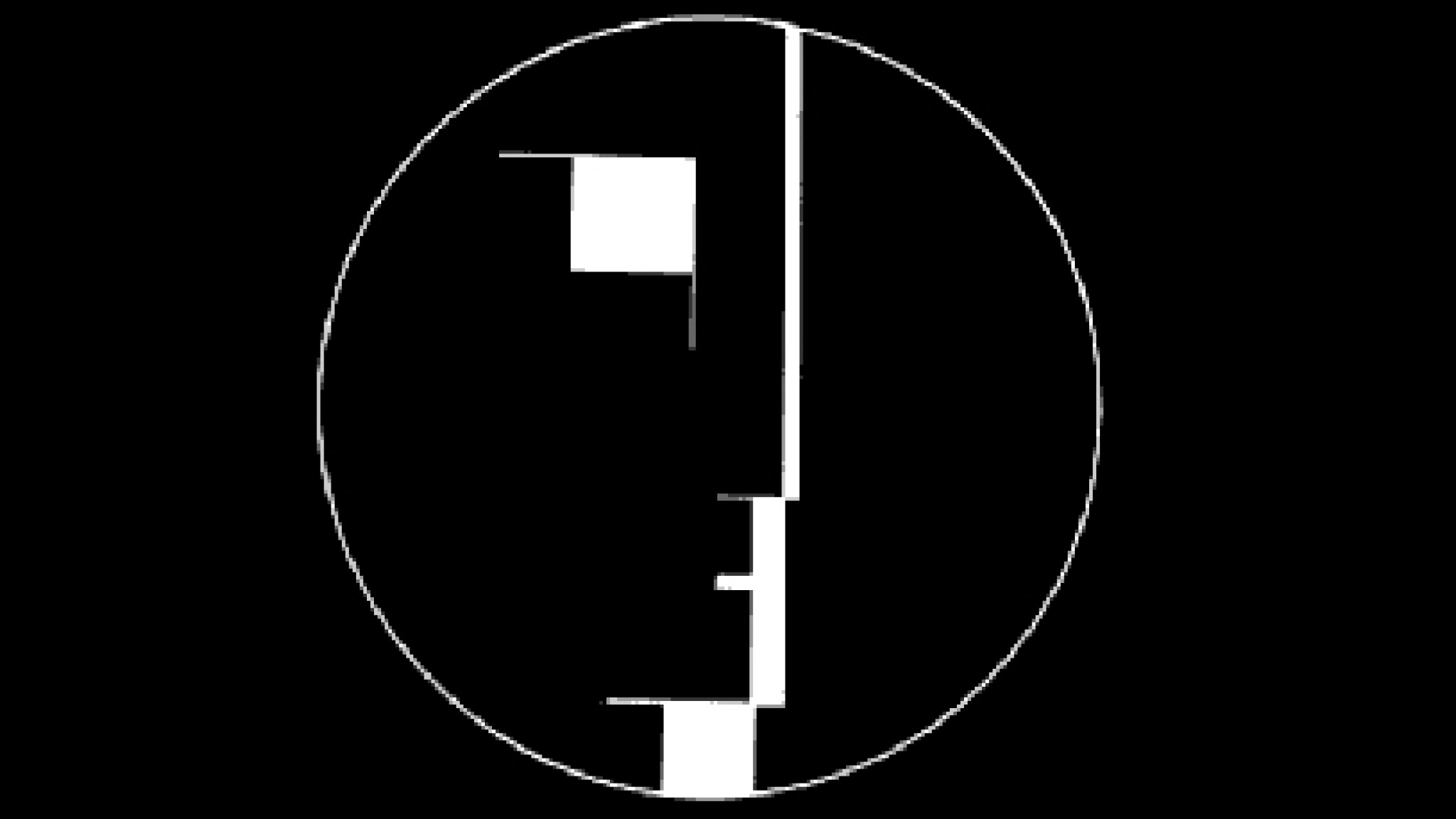Wahnsinn durch Schönheit

Ein bisschen Größenwahn gehörte zum Geist der Zeit. Schließlich hatte die Menschheit im Allgemeinen und Europa im Speziellen eben erst in Form des ersten Weltkrieges die bis dato größte Katastrophe ihrer Kultur erlebt. So wundert es auch wenig, dass Paul Hindemith erklärte, er wolle die größte Oper überhaupt verfassen, und damit an das Absurde des Welttheaters anknüpfte. Tatsächlich gestaltete sich aber dieses Vorhaben als gar nicht so leicht. Erst einmal musste ein Thema gefunden werden, das sich auch für ein derart hochtrabendes Projekt eignete. Nach einigem Zaudern entschied sich Hindemith für die Umarbeitung einer Sequenz aus E.T.A. Hoffmanns Novelle “Das Fräulein zu Scuderi”, die Geschichte des wahnsinnigen Goldschmieds “Cardillac”.
Paul Hindemith hatte etwas gegen Konventionen. Alles, was ihm zu berechenbar erschien, war ihm suspekt, und so hatten seine Zeitgenossen es schwer, ihm einen Platz in der Sukzession der musikalischen Ereignisse zuzuweisen. Wo sich sonst die Entwicklung von der Klassik und Romanik über den Expressionismus bis hin zur Serialität vorzeigen ließ, hatten es die Spezialisten im Fall von Hindemith mit einem genialischen Einzelgänger zu tun, der kraft seine kreativen Kompetenz sowohl die Atonalität wie das serielle Komponieren ablehnte, aber genauso wenig zur Tradition Wagnerscher, französischer oder russischer Prägung neigte. Im Gegenteil: Hindemiths Weg war ein verschlungener, der zahlreiche deutliche Spuren in der Musikgeschichte hinterließ.
Er gehörte zu den Initiatoren der Donaueschinger Musiktage ebenso wie zu den Revolutionären der Berliner Kulturszene der Zwanziger, er half um Auftrag des türkischen Staates maßgeblich an der Organisation des dortigen Musiklebens mit und brachte als Professor in Yale eine ganze Generation junger Kollegen auf den Weg. Bei aller Lösung von den Traditionen behielt er klar den Impetus des Musikantischen in seiner Kunst, die schließlich in den späten Jahren auch nach der Verankerung im Transzendenten suchte. Verfemt von den Nazis, verehrt vom Rest der Welt zählt er heute zu den Ahnherren der Moderne, dessen Kunstvorstellung die Avantgarde bis zur Gegenwart inspiriert.
Hindemiths Klangwelt ist von einer besonderen hypnotischen Dichte geprägt. Für den Regisseur und Opernvisionär Jean-Pierre Ponnelle, eine halbes Jahrhundert nach der Uraufführung von “Cardillac” (1926) selbst ein Mann mit eigener ästhetischer Geschichte, war es daher eine besonders reizvolle Aufgabe, sich des Werkes des jungen Revoluzzers anzunehmen und an der Münchner Staatsoper auf die Bühne zu bringen. Dabei knüpfte er bewusst an die Kunstformen an, die das kulturelle Leben zur Zeit der Entstehung der Oper bestimmten. Seine Inszenierung hat viel von surrealen Phantasiewelten der zwanziger Jahre, von Fritz Lang und den Formalisten, manchmal einen Hauch von Futurismus, aber vor allem viel Stummfilmhaftes in der Lichtgestaltung, der Maske der Schauspieler und der häufig dem gewohnten Raumempfinden des Zuschauers entgegen stehenden Perspektiven. Der Wahnsinn eines Dr. Caligari wird in den Räumen zitiert, in denen man jeden Moment den Golem um die Ecken biegen lassen könnte, die aber in diesem Fall von Cardillac, dem wahngetriebenen Juwelier beherrscht werden, der es nicht ertragen kann, seine Schmuckstücke weg zu geben. Er wird daher zum Mörder seiner Kunden, bis der Liebhaber seiner Tochter ihn enttarnt und er vom Volkszorn gemeuchelt wird. Dabei geht Hindemith durchaus hart mit der Selbstjustiz ins Gericht und lässt den Liebhaber und Offizier den Pöbel in einer ergreifenden Schlussarie anklagen, einer Szene, die im Halbdunkel der Bühne gespenstische Direktheit entwickelt.
Überhaupt zeichnet sich die von Brian Large verwirklichte Filmversion durch ein beeindruckendes Zusammenspiel einer grandiosen Inszenierung, ausgezeichneter Solisten wie Donald McIntyre in der Titelrolle und Maria de Francesca-Cavazza als Cardillacs Tochter, eines von Wolfgang Sawallisch furios geleiteten Bayerischen Staatsorchesters und einer einfühlend intelligenten Kameraführung aus, der es gelingt, die Kraft dieses Bühnenereignisses auch in der zeitlichen Distanz eindrucksvoll mitzuteilen.